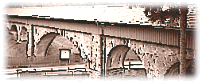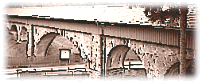|
Literatur
Drucke |
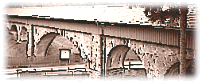 |
Paul Lauerwald und Siegfried Wietstruk
Ortschroniken - warum, was, wie
Berlin (Ost) 1983
Dieses Buch sollte zu DDR-Zeiten das Schreiben von Ortschroniken in staatlich gelenkte Bahnen zwingen. Es wurde zwar nicht so deutlich ausgesprochen, doch man erwartete eine Huldigung an die Leistungskraft von Arbeiterklasse und Sozialismus. Und ein strenges Verurteilen anderer Gesellschaftsordnungen. - Ortschroniken, die nicht nach den genannten Regeln abgefasst waren, konnten keinesfalls öffentliche Anerkennung finden; im Gegenteil, sie waren verdächtig, Ideologie des ewig-gestrigen Klassenfeindes unters Volk zu bringen ... entsprechend langweilig und lebensfern ist dieses Buch, und man muss es sich nicht antun, es zu lesen. Die folgenden Auszüge sollen das dem DDR-unkundigen Leser ein wenig vermitteln.
- Grundlage für Ortschroniken ist das Gesetz "Verordnung über Ortschroniken" vom 26. 11.1981
- Das Führen von Ortschroniken war in verschiedenen deutschen Kleinstaaten bereits im 19. Jahrhundert vorgeschrieben
- Der Chronist soll nicht nur sammeln, sondern sein Material auch öffentlich zugänglich machen. "Die Auswertung der Materialien ... sollte ... eine isolierte lokale Betrachtung vermeiden."
"Solche bedeutsamen Geschehnisse wie die Parteitage müssen ihren Niederschlag in der Ortschronik finden."
- In jeder Ggemeinde ist eine Ortschronik zu führen. Der Iststand zur Zeit der Veröffentlichung lag allerdings erst bei 15 - 30 Prozent (1). In Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern ist die Arbeit des Ortschronisten hauptamtlich (also eine Vollbeschäftigung)
- Es sind Arbeitsgruppen zu bilden zur Erforschung und Propagierung der Regional- und Heimatgeschichte. Diesen Gruppen sollen Vertreter des Staatsorgans (Rat des Kreises) und Abgeordnete angehören. Zu empfehlen ist es, dafür Mitglieder des Kulturbundes zu gewinnen (2), sowie Archivare, Kreisfachberater für Geschichte (an den Schulen), Kreisgeschichtskommission der SED
- Es sollen unbedingt die bereits tätigen Chronisten zum Ortschronisten berufen werden. Weil sie sonst die gesammelten Materialien als persönlichen Besitz betrachten werden und privat bei sich aufbewahren.
- "Werden die Materialien für die Ortschronik im Auftrag des Rates gesammelt, so sind sie kein persönliches Eigentum" (3)
- Der Orstchronist ist gegenüber dem örtlichen Rat rechenschaftspflichtig
- Die Aufbewahrung der Materialien erfolgt im Gebäude des Rates. Dort sollte auch eine Arbeitsmöglichkeit geschaffen werden (4)
- Die Datensammlung soll nach folgenden Kategorien
- Politische Entwicklung
- Ökonomische Entwicklung
- Soziale Entwicklung
- Geistig-kulturelle Entwicklung
- Bevölkerungs- und Siedlungsverhältnisse
- Naturverhältnisse
- Umweltgestaltung
und nach folgenden Zeitabschnitten gegliedert sein
- bis 5. Jahrhundert
- 5. Jahrhundert bis zur französischen Revolution 1789
- 1789 bis 1945
- 1945 bis 1961
- seit 1961
(5)
- Die zu sammelnden Erkenntnisse sind auf Karteikarten festzuhalten. Über notwendigen Postverkehr ist ein Eingangs- und Ausgangsbuch zu führen
- Bei notwendigen Qualifizierungen ist auf die Führungsrolle der SED zu achten (6).
- und es steht zu vermuten, dass diese Zahlen (wie überall in der DDR) straff nach oben aufgerundet waren.
- die möglichst in der Partei waren siehe Kommentar zu den Mogel-Wahlen 1989
- und (nur mündlich) auch eventuelle Kopien zu Hause sind nicht zulässig
- Welch panische Angst, der Forscher könne Dinge entdecken, die der Partei nicht gefallen, und diese Entdeckungen bei sich verstecken!
- Die erste Aufzählung ist auch eine Rangfolge, die zweite schreibt die zeitliche Wichtung der zu sammelnden Daten fest.
- Im Klartext: Zur Qualifizeirung dürfen nur Parteigenossen fahren.
In solch ein Krampf-Kollektiv wollte man auch die Autoren um 1984 einbinden. Doch es wurde nichts daraus ...