1921 - 1964
Notizen zu den Glocken
Kirchenarchiv Krumhermersdorf
| S. 7 | Marienthal | 1490 |
| S. 30 | Reinsdorf | 1466 |
| S.49 | Ebelsbrunn | 1432+1436* |
| S. 50 | Bockwa | 1484+1487 |
| S. 62 | Dorfchemnitz | 1470?
(oder 1419) |
| S. 66 | Baiersdorf | 1464 |
| S. 91 | Erlbach | 1475 |
| S. 107 | Stenn (vgl S. 14) | 1434* |
| S. 111 | Weißenborn
(vgl. S. 76) | 1498+1480 |
| S. 136 | Waldkirchen | 1472 |
| S. 180 | Eibenstock | 1480 |
| S. 186 | Niederrabenstein | 1459 |
| S. 194 | Zwickau | 1482 |
|

Sachsens Kirchengalerie (um 1840) beschreibt ausführlich all die Kirchenglocken ihres Gebietes. Die Tabelle zeigt Glocken vor 1500. Die mit * bezeichneten Glocken tragen nur Jahreszahl und die Namen der vier Evangelisten. Man kann also annehmen, das in der hiesigen Gegend erst um 1430 Glocken mit Text aufkamen, und erst um 1460 längere Sprüche Mode wurden.. Die Krumhermersdorfer Sau-Glocke (völlig ohne Inschrift) dürfte demnach vor 1430 gegossen worden sein - das würde zur Bauzeit der Kirche um 1400 passen.
Die o.g. Kirchengalerie erwähnt übrigen ZWEI solche alte Glocken. |
 Die Kirchrechnungen
Die Kirchrechnungen
1602 bis 1635 werden in den Kirchrechnungen 3 Glocken erwähnt: Die Große, die Mittlere und die Kleine genannt. Der begriff "Sau-Glocke" taucht nicht auf. Des weiteren werden "zwei klein Glöcklein auf der Pfarr" (dem Pfarrhaus) erwähnt, die 1632 zusammen mit diesem verbrennen.
 Schul- und Heimatfest 1935
Schul- und Heimatfest 1935
Die dort gegebene Darstellung ist falsch! Wahrscheinlich wurde da "fix was zusammengeschrieben ... Richtig findet man die Darstellung um alte und neue Glocken in

 den beiden Kirchengalerien Sachsens
den beiden Kirchengalerien Sachsens
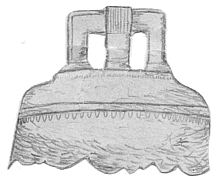 Die Sau-Glocke hat eine raue, poröse Oberfläche ohne Text und Bild. Die einzige Verzierung sind dünne Bogen (Halb-Ellipsen) unter dem oberen Kranz, ca 2cm hoch und 1 cm breit. Der untere Rand weist viele kleine Scharten auf.
Die Sau-Glocke hat eine raue, poröse Oberfläche ohne Text und Bild. Die einzige Verzierung sind dünne Bogen (Halb-Ellipsen) unter dem oberen Kranz, ca 2cm hoch und 1 cm breit. Der untere Rand weist viele kleine Scharten auf.
Frau Schilling von der Apoldaer Glockengießerei (dazu befragt) führt die Oberfläche auf noch wenig entwickelte Gießtechnik zurück und NICHT auf eine Lagerung im Boden über Jahrhunderte.
Der Sage nach wurde diese Glocke von weidenden Schweinen ausgewühlt. Als Fundort nennen einige Autoren (naheliegenderweise) den Kirchhof im Bornwald und bezeichnen diese Glocke darum als ehemalige Berthelsdorfer Glocke.
Diese Sage kam um 1900 herum auf. 1904 schreibt der Pfarrer in der  Neuen sächsischen Kirchengalerie, die Glocke sei sehr alt und stamme wahrscheinlich aus dem zerstörten Berthelsdorf im Bornwald. . Pfarrer Müller (ab 1920) nennt sie bereits mit Überzeugung "Sauglocke", und dieser Name blieb an ihr kleben.
Neuen sächsischen Kirchengalerie, die Glocke sei sehr alt und stamme wahrscheinlich aus dem zerstörten Berthelsdorf im Bornwald. . Pfarrer Müller (ab 1920) nennt sie bereits mit Überzeugung "Sauglocke", und dieser Name blieb an ihr kleben.
Obwohl es keinerlei Beweis dafür gab. Vielmehr einige Indizien, die dagegen sprechen:
- Es fand sichim Kirchenarchiv kein einziger Hinweis auf solch einen Glockenfund. Trotz intensivem Suchen!
- Die Glocke ist ziemlich genau so alt wie die Krumhermersdorfer Kirche
- Berthelsdorf war mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit KEIN Kirchdorf. Für eine eventuell dort vorhandene Friedhofskapelle (die aber auch nicht belegt ist), wäre solch eine Glocke unverhältnismäßig groß gewesen.
Zu vermuten ist, dass Krumhermersdorfer Einwohner ein gehörtes VIELLEICHT dem neuen Pfarrer als altehrwürdig-überkommene Volkssage verrieten ...
 1921: Johannes Öhme, Strumpffabrikant in Krumhermersdorf, überweist 1.000 Mark für neue Glocken (1)
1921: Johannes Öhme, Strumpffabrikant in Krumhermersdorf, überweist 1.000 Mark für neue Glocken (1)
- 1921: Bruno Pietzel & Co, Glockengießerei Dresden-Radebeul, nimmt den Auftrag an, neue Glocken zu gießen und schlägt vor:
- Material zu kaufen: 77-80% Kupfer, 23-20% Zinn und zerschlagene alte Glocken mit zu verwenden
- Die kleine Glocke 105 kg, Ton e2 + kleine Terz
die mittlere Glocke 178 kg, Ton cis2 und kleine Terz
die große Glocke 355 kg, Ton a1 und kleine Terz
alle auf den Kammerton 870 Hz gestimmt
- der Materialpreis betrug 42 Mark/kg, das macht 26.796 Mark insgesamt
- Verzierungen nach den Wünschen der Gemeinde: Stern, strahlender Kranz, Taube
Die Sau-Glocke bringt dazu 337,9 kg Material mit
- 1921: Das Landeskosistorium, Inspektion Krumhermersdorf, erhebt Einspruch gegen das Einschmelzen der Sau-Glocke.
Wenn das 1921 stattfand, dann hat die Sau-Glocke offenbar den Krieg überlebt. Warum? Schien ihre sehr alte Legierung für die Granaten-Herstellung ungeeignet? Oder kamen weniger historische Glocken zuerst in den Tiegel? Wohl eher das Erstere, denn sonst hätte man nicht drei Jahre NACH dem Krieg solche eine Glocke für das Einschmelzen vorgesehen.
- 1921: Das Landeskonsistorium genehmigt das Einschmelzen der Glocke doch noch.
- 1922: Wegen der Inflation verzögert sich der Glockenguß. Schließlich wird ein Preis von 120 Zentnern Getreide vereinbart und schließlich wird Hafer zum Bezahlen genutzt
- Dafür erhält Krumhermersdorf 3 zusammenpassende neue Glocken.
Wie wurde die kleine Glocke dann gerettet? Aus den Unterlagen der Kirche geht nichts dazu hervor.  R. Timme schreibt 1930, die Glocke befinde sich im Besitz des Fabrikanten F.H. Öhme. Pfarrer Müller schreibt in der
R. Timme schreibt 1930, die Glocke befinde sich im Besitz des Fabrikanten F.H. Öhme. Pfarrer Müller schreibt in der  Kirchenchronik, daß der Fabrikant Emil Öhme diese Glocke der Gießerei wieder abkaufte. Irgendwie kam diese Glocke dann vor 1940 in den Besitz des Erzgebirgsvereins, der sie aber auf dem Turm beließ.
Kirchenchronik, daß der Fabrikant Emil Öhme diese Glocke der Gießerei wieder abkaufte. Irgendwie kam diese Glocke dann vor 1940 in den Besitz des Erzgebirgsvereins, der sie aber auf dem Turm beließ.
- 1941: Die zwei großen Glocken werden beschlagnahmt. Sturmläuten ist ab sofort verboten.
- 1948: Die "Heimatfreunde", Rechtsnachfolger des Erzgebirgsvereins, weisen auf ihr Eigentumsrecht an der Sau-Glocke hin.
Nach mündlicher Überlieferung gab es einige bürokratische Schikanen, die den Abtransport der Sau-Glocke 1941 verhinderten. Sie wurde bei einem Vereinsmitglied (Gasthof Timmel, im Oberdorf) auf dem Boden gelagert bis zum Ende des Krieges, dann aber wieder auf den Turm gehängt.
- 1949: Die beiden abgelieferten Glocken sind weg, eingeschmolzen.
- 1954: Der ehemalige Erzgebirgsverein, jetzt Kulturbund/Heimatfreunde muss sein Eigentum melden, verschweigt aber die Glocke. Dieser halblegale Zustand führt vielleicht zum Entschluss, die Glocke zu verkaufen.
- 1958: Die Kirchgemeinde kauft eine kleine Glocke. Diese und die eine verbliebene kleine Glocke sollen umgeschmolzen werden, um klanglich zur Sau-Glocke zu passen.
- 1958: Der Glocken-Sachverständige meint, die Sau-Glocke sei durch Brand gegangen (2)
- 1960: Die Glocken sind gegossen und werden am 11.09.1960 geweiht.
- 1964: Die Heimatfreunde (Kulturbund der DDR) verkaufen die Sau-Glocke für 250,- DM (DDR-Mark) an die Kirchgemeinde. Den Vertrag unterschreiben Pfarrer Fischer und Kurt Keilig, Kulturbund-Vorsitzender. Es wird ein Rückkaufrecht vereinbart, falls die Glocken ohne höhere Gewalt vom Turm entfernt werden.
- Die alten Glocken waren als "Meltallabgabe" im 1. Weltkrieg durch die Regierung beschlagnahmt worden.
- Das wurde später von der Apoldaer Glockengießerei als sehr fraglich hingestellt.


 Die Kirchrechnungen
Die Kirchrechnungen Schul- und Heimatfest 1935
Schul- und Heimatfest 1935
 den beiden Kirchengalerien Sachsens
den beiden Kirchengalerien Sachsens
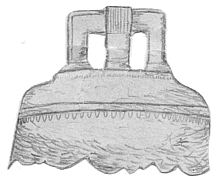 Die Sau-Glocke hat eine raue, poröse Oberfläche ohne Text und Bild. Die einzige Verzierung sind dünne Bogen (Halb-Ellipsen) unter dem oberen Kranz, ca 2cm hoch und 1 cm breit. Der untere Rand weist viele kleine Scharten auf.
Die Sau-Glocke hat eine raue, poröse Oberfläche ohne Text und Bild. Die einzige Verzierung sind dünne Bogen (Halb-Ellipsen) unter dem oberen Kranz, ca 2cm hoch und 1 cm breit. Der untere Rand weist viele kleine Scharten auf. Neuen sächsischen Kirchengalerie, die Glocke sei sehr alt und stamme wahrscheinlich aus dem zerstörten Berthelsdorf im Bornwald. . Pfarrer Müller (ab 1920) nennt sie bereits mit Überzeugung "Sauglocke", und dieser Name blieb an ihr kleben.
Neuen sächsischen Kirchengalerie, die Glocke sei sehr alt und stamme wahrscheinlich aus dem zerstörten Berthelsdorf im Bornwald. . Pfarrer Müller (ab 1920) nennt sie bereits mit Überzeugung "Sauglocke", und dieser Name blieb an ihr kleben. 1921: Johannes Öhme, Strumpffabrikant in Krumhermersdorf, überweist 1.000 Mark für neue Glocken (1)
1921: Johannes Öhme, Strumpffabrikant in Krumhermersdorf, überweist 1.000 Mark für neue Glocken (1) R. Timme schreibt 1930, die Glocke befinde sich im Besitz des Fabrikanten F.H. Öhme. Pfarrer Müller schreibt in der
R. Timme schreibt 1930, die Glocke befinde sich im Besitz des Fabrikanten F.H. Öhme. Pfarrer Müller schreibt in der  Kirchenchronik, daß der Fabrikant Emil Öhme diese Glocke der Gießerei wieder abkaufte. Irgendwie kam diese Glocke dann vor 1940 in den Besitz des Erzgebirgsvereins, der sie aber auf dem Turm beließ.
Kirchenchronik, daß der Fabrikant Emil Öhme diese Glocke der Gießerei wieder abkaufte. Irgendwie kam diese Glocke dann vor 1940 in den Besitz des Erzgebirgsvereins, der sie aber auf dem Turm beließ.