
Drucke
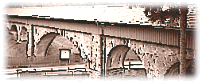
 |
Literatur Drucke |
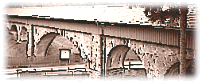 |
 Berthelsdorf-Beitrags.
Berthelsdorf-Beitrags.
In den Dörfern rund um den Heinzewald hat sich bis heute die Überlieferung erhalten, daß sich hier in der Vergangenheit der Ort Berthelsdorf befunden haben soll. Durch kriegerische Ereignisse zerstört, sei er nie wieder aufgebaut worden. Obwohl die Sage in der Literatur häufig ihren Niederschlag fand, zeigt gerade eine  jüngste Veröffentlichung, daß es in der Bevölkerung nach wie vor Unklarheiten zum historischen Sachverhalt gibt.
jüngste Veröffentlichung, daß es in der Bevölkerung nach wie vor Unklarheiten zum historischen Sachverhalt gibt.
Auch wenn der Ort für den Laien nicht mehr auffindbar ist, kann der Historiker die ehemalige Siedlung im Gelände nachweisen. Sie befand sich südöstlich von Krumhermersdorf am Grenzbach, dessen Gelände sich durch die sanft ansteigenden Hänge gut für die Anlage einer Siedlung eignete. Hier sind viele wüstungstypische Merkmale, wie Unebenheiten im Waldboden, alte Teichdämme oder verfallene Wege zu finden. Auch liegen aus dem Grenzbachtal Scherben mittelalterlicher Keramik vor (2).
Die urkundliche Ersterwähnung von Berthelsdorf erfolgte am 8. Januar 1369. Im Kopial eines markmeißischen Lehnbriefes für die Waldenburger wird u. a. " ... die Czupe halb Bertholdesdorph..." genannt. Das Wort "halb" bezieht sich nach Interpretation des Staatsarchivs Dresden auf das nicht mehr zu Iokalisierende Waldstück "Czupe" (3) und gibt demzufolge zu einer angenommenen Teilung von Berthelsdorf keinen Anlaß.
Parallel zur Einbindung des Ortes in die Herrschaft Rauenstein dürfte eine kirchliche Zuordnung (4) zu Lengefeld, dem Pfarrort der Herrschaft, vorgelegen haben. Auf die Möglichkeit des Vorhandenseins eines Sakralbaues in Berthelsdorf weist der erstmals um 1600 überlieferte Flurname "Kirchhof" in Grenzbachnähe hin (5). Berthelsdorf befand sich in der Nähe des um die Mitte des 12. Jahrhunderts genannten "böhmischen Steiges" Rochlitz - Rübenau. Dessen Verlauf sieht im behandelten Territorium konkretisiert folgendermaßen aus: Nach dem Passieren der Zschopaufurt im Bereich der heutigen Brücke ist für die weitere Trassierung der Weg "Am Zschopenberg" richtungweisend, der sich bis nach Hohndorf fortsetzt. Von da aus entspricht die heutige Führung der F 174 von der Einmündung der Alten Marienberger Straße bis nach Großolbersdorf in etwa dem einstigen böhmischen Steig. Hinter der "Roten Pfütze" bog die Altstraße nach Südosten ab, wobei ein Feldweg heute noch die Richtung angibt. Den Heinzewald durchstreifend, überquerte man unmittelbar nördlich des "Roten Pfützenteiches" die heutige F 101 (6). Nunmehr strebte die Trasse in östlicher Richtung Lauterbach zu, von wo über Niederlauterstein, Zöblitz und Ansprung Rübenau erreicht wurde. Die dargelegte Altstraßenführung läßt sich im Gelände durch eine Reihe von erhaltenen Altstraßenresten - Hohlwegen - gut verfolgen (7).
Die Berthelsdorfer Siedler kamen aus dem thüringisch-fränkischen Raum über diesen böhmischen Steig und suchten für die Anlage eines Ortes in dessen Nähe, am Grenzbach, einen siedlungsgünstigen Platz aus. Dabei entstanden auch örtliche Verbindungen zwischen den umliegenden Siedlungen wie auch Anschlußwege zum sich zur hochmittelalterlichen Straße entwickelnden böhmischen Steig.
Nach bisheriger Erkenntnis bestand Berthelsdorf etwa bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts. Die zur Wüstwerdung des Ortes führenden Gründe kennen wir nicht im einzelnen. Mit Sicherheit sind sie vielschichtig und lassen sich nicht auf Epidemien oder Zerstörung durch Kriegseinwirkung reduzieren (8).
Definitive Aussagen zur Wüstung Berthelsdorf sind in Zukunft ohnehin nur durch gezielte ärchäologische Untersuchungen an Ort und Stelle zu erreichen. Diese müssen aber den Fachwissenschaftlern vorbehalten bleiben.
An die
Freie Presse, Lokalredaktion Zschopau
Mit Befremden las ich o.g. Veröffentlichung, die eine Antwort auf einen Beitrag unsererseits im Jahrbuch Erzgebirge 88 darstellt. Schon in der Überschrift ist die Rede von "Spekulationen". Gewiß sind Frau Wißuwas Argumente nachdenkenswert. Ich fände es normal, wenn sie darüber zunächst mit uns ins Gespräch käme. Ich fände es noch akzeptabel, wenn dieser Beitrag in einer heimatkundlichen Zeitschrift erschiene. Aber ein Beitrag für die Tagespresse, deren Leser in der Mehrzahl das Problem nicht kennen, ist das nicht. Und erst recht nicht in dieser Form, denn auch gegen Frau Wißuwas Argumente gibt es schwerwiegende Einwände.
Umso ärgerlicher fand ich jenen  zweiten Beitrag. Die Arbeitsgruppe um Dr. Brenner hat sich in jedem Fall wesentlich länger mit diesem Problem befaßt als Frau Wißuwa (ich kenne beide persönlich). Natürlich ist das keine Gewähr gegen Fehler. Doch auch hier wäre wohl der Weg des persönlichen Gesprächs - und bei nicht klärbaren Differenzen die Veröffentlichung in der Fachpresse angemessen.
zweiten Beitrag. Die Arbeitsgruppe um Dr. Brenner hat sich in jedem Fall wesentlich länger mit diesem Problem befaßt als Frau Wißuwa (ich kenne beide persönlich). Natürlich ist das keine Gewähr gegen Fehler. Doch auch hier wäre wohl der Weg des persönlichen Gesprächs - und bei nicht klärbaren Differenzen die Veröffentlichung in der Fachpresse angemessen.
Kurz und gut - ich halte beide Artikel für sehr einseitig und tendenziös ...
Hermann Doerffel
 Doktorarbeit habe ich gelesen. Diese Arbeit macht den Endruck einer gewaltigen Materialsammlung, doch scheint mir das gesammelte Material nicht sonderlich gründlich auf Übereinstimmung mit der Realität geprüft zu sein. Eben diesen Eindruck macht auch der vorliegende Beitrag: Oberflächlich und unduldsam gegen andere Ansichten.
Doktorarbeit habe ich gelesen. Diese Arbeit macht den Endruck einer gewaltigen Materialsammlung, doch scheint mir das gesammelte Material nicht sonderlich gründlich auf Übereinstimmung mit der Realität geprüft zu sein. Eben diesen Eindruck macht auch der vorliegende Beitrag: Oberflächlich und unduldsam gegen andere Ansichten. Beitrag gegen Ansichten des Parteigenossen und Geschichtslehrers Brenner aus Zschopau vertieft diesen Eindruck noch.
Beitrag gegen Ansichten des Parteigenossen und Geschichtslehrers Brenner aus Zschopau vertieft diesen Eindruck noch.
 Hengst 1986
Hengst 1986